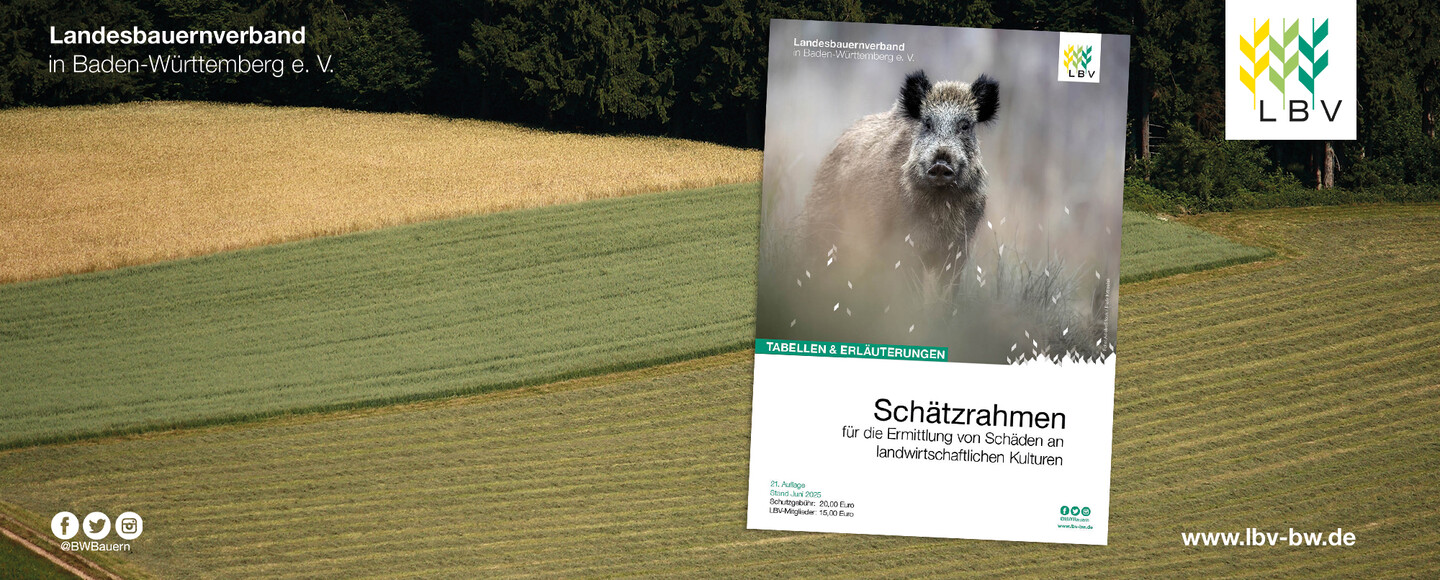Hohenloher Bauerntag
Für mehr Sachlichkeit statt zunehmender Polarisierung
Alle Demokraten sind gefordert, die derzeit enorme gesellschaftliche Polarisierung zu entschärfen. Dieser Ratschlag zur Lösung der ganz großen Konflikte kommt von Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Klaus Mugele, der Vorsitzende des Bauerverbandes Schwäbisch Hall-Hohenlohe-Rems, rief vor mehr als 600 Besuchern des Hohenloher Bauerntags in Kupferzell dazu auf, damit auch im lokalen Umfeld und innerhalb der Landwirtschaft anzufangen.
„Jene Gruppen, die glauben, man bräuchte eine Agrarwende, um die Gesellschaft vor uns Bauern zu schützen, verweigern sich einer konstruktiven Diskussion“, stellte Mugele klar. „Dem Bauernverband reicht es nicht, dagegen zu sein.“ Er hält den gesellschaftlichen Konsens für notwendig. Im Vorfeld der alljährlichen „bunten Demo“ zur Grünen Woche, bei der Beschimpfungen und Verunglimpfungen der Tierhalter regelmäßig dazu gehören, habe der Bauernverband unter dem Motto „Redet mit uns statt über uns!“ den Kontakt zu anderen Gruppen gesucht, vorweg zu ‚Brot für die Welt‘,. Es konnte in diesem Jahr dadurch einiges an Schärfe und Aggressivität aus den Demo-Ankündigungen herausgenommen werden. Mugele zeigte sich optimistisch, dass weitere Gruppen den Austausch wollen. Mit Brot für die Welt sei man sich einig, dass der bisherige Hickhack keine Zukunft hat.
Einen sehr vernünftigen Ansatz nannte Klaus Mugele das Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats für einen gesellschaftlichen Grundkonsens über die künftige Tierhaltung, wie es der Beiratsvorsitzende, Professor Harald Grethe, den Mitgliedern vergangenen November erläuterte. Danach handelt es sich um einen Prozess, der Jahrzehnte dauern wird und in dem die Ansprüche aller Beteiligten auf Augenhöhe unter eine Hut gebracht werden müssen. Dies bedeute eine Abkehr von einseitigen Forderungen der Tierschützer und Tierrechtler, die immer nur Änderungen abfordern, ohne nur im Geringsten darüber nachzudenken, welche Auswirkungen das auf die Tierhalter hat.
Zu Veränderungen bereit
Mugele bekräftigte die von Bauernverbandspräsident Rukwied vielfach ausgesprochene Bereitschaft zu Veränderungen. Dazu brauchen die Bauernfamilien Wertschöpfung und erwarten Wertschätzung. „Neben auskömmlichen Erzeugerpreisen ist es genau das, was am meisten vermisst wird: ein ehrlicher Umgang und eine angemessene Wertschätzung“, sagte Mugele unter dem Beifall der Zuhörer.
Grottenfalsche und abwegige Behauptungen
Die Vorstellung, „Wachsen oder Weichen“ sei eine Forderung der Bauernverbandes, bezeichnete Mugele genauso abwegig wie die Behauptung, der Verband setze vor allem auf die Weltmärkte für Agrargüter. Grottenfalsch liege daher der frühere Wirtschaftsstaatssekretär der Grünen, Rezzo Schlauch, mit seiner Kritik, die er zuvor beim Bauerntag der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall in Wolpertshausen und in der regionalen Presse zum Ausdruck gebracht hatte. „Hätte er sich kundig gemacht, dann wüsste er, dass unsere Erzeugnisse zu drei Viertel im Land verbleiben. 20 Prozent gehen in die EU und lediglich fünf Prozent in Drittländer“, kontert Mugele. „Kein Landwirt in Hohenlohe stürzt sich auf den Weltmarkt. Doch was sollte dagegen sprechen, wenn ein Teil unserer Erzeugung irgendwo auf der Welt eine Absatz findet und damit der Absicherung unsere Erzeugerpreise dient?“, fragt der Bauernverbandsvorsitzende. „Was soll die Forderung nach einer Agrarwende?“
Der Markt für Erzeugnisse der Bauern sei so groß und vielfältig wie die Verbraucherwünsche. „Er bietet Platz für alle“, betont Mugele und merkt selbstbewusst an: „Wer uns Bauern mit politischer Macht wenden will, wird auf Granit beißen und ignoriert die Mehrheit der Bevölkerung. Sie schätzt die Vielfalt unserer Produkte, weil sie gut und schmackhaft sind.“
Gefühlte und tatsächliche Risiken aus Stall und Acker
„Aus naturwissenschaftlicher Sicht sind Lebensmittel heute deutlich sicherer und qualitativ hochwertiger als sie es jemals waren“, versicherte Dr. Gaby-Fleur Böl, die am Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) in Berlin die Abteilung Risikokommunikation leitet. In ihrem unterhaltsamen Vortrag nannte sie Gründe, warum dies von der Bevölkerung so nicht wahrgenommen wird.
Das BfR will dazu beitragen, dass die Arbeit und Leistung der Landwirte und ihre guten Produkte entsprechend gewürdigt und geschätzt werden. Nicht zuletzt entstehe ein schiefes Bild über die Lebensmittelsicherheit und drohende Gefahren durch die Medien. Hier geraten beim Vergleich der Risiken häufig solche in den Blickpunkt, von denen statistisch gesehen die wenigste Gefahr ausgehen.
Hauptaufgabe des unabhängigen, rein aus Steuermitteln finanzierten BfR sei es, über gesundheitliche Risiken und Gefahren aufzuklären. Es unterscheidet, wo Hilfe nötig ist und in welchen Fällen weder ein Skandal noch ein gesundheitliches Problem vorliegt und keinerlei Handlungsbedarf besteht. Dies zu unterscheiden, fällt dem Verbraucher schwer.
Angst vor dem Schnitzel
Es herrscht die ‚Angst vor dem Schnitzel‘ und eine Riesenspanne zwischen dem, was ist und dem, was die Leute glauben, wie es ist. Nach einer jüngsten Erhebung sehen immer noch elf Prozent der Deutschen gesundheitliche Risiken durch ungesunde oder belastete Lebensmitteln. Warum so viele Menschen ihren eigenen Lebensmitteln misstrauen, liegt zum Teil an den immer genaueren analytischen Messverfahren und deren permanenten medialen Auswertung.
Böl räumte mit dem weit verbreiteten Irrglaube über Grenzwert oder Höchstgehalte in Lebensmittel auf. Sie würden nicht zwischen giftig und ungiftig sondern lediglich darüber entscheiden, ob das Lebensmittel handelbar ist. Zwischen der Dosis im Tierversuch mit ersten nachweisbaren gesundheitlichen Einschränkungen und dem Grenzwert, der für den menschlichen Verzehr gesundheitlich unbedenklich ist, liegt ein gesetzlich vorgeschriebener Sicherheitsfaktor, der hundert Mal niedriger ist.
Über- und unterschätzte Risiken
Die ausgebildete Biochemikerin Böl sieht keine Probleme in angeblich zu hohen Pflanzenschutzmittel-Rückständen. Alles, was chemisch daherkommt, werde risikomäßig grandios überschätzt, während die Gefahren durch Infektionskrankheiten, übertrage vom Tier zu Mensch oder von Mensch zu Mensch gerne unterschätzt werden.
Den Nachweis führte die Risiko-Expertin an Beispielen aus dem Jahr 2011, als beim Dioxin-Skandals Futtermischungen mutwillig mit dem Gift vermischt worden sind und als beim EHEC-Skandals Bockshornklee mit dem gefährlichen Bakterium verseucht war. Während im erste Fall beim Verzehr von Eier oder Fleisch keinerlei gesundheitliche Gefahren bestanden hatte, sind durch das EHEC-Bakterium damals 53 Menschen allein in Deutschland gestorben und mehr als 4000 Menschen verletzt (Nierenschäden) worden. Eine nachträgliche Erhebung unter Verbraucher hat dennoch ergeben, dass beide Lebensmittel-Skandale als etwa gleich schlimm wahrgenommen wurden.
Die Schuld an Antibiotikaresistenzen allein der Landwirtschaft in die Schuhe zu schieben ist wissenschaftliche nicht korrekt, betonte Böl. Alle Daten würden dafür sprechen, dass der unsachgemäße Gebrauch in der Human- und Veterinärmedizin gleichermaßen zu dem Problem beitragen. Dagegen sind selbst antibiotikaresistente Erreger im Fleisch für den Menschen unproblematisch, wenn die allgemeinen Regeln zur Küchenhygiene und eine zweiminütige Kerntemperatur von 70 Grad C im Fleisch eingehalten werden.
Gewaltig unterschätz werden dagegen die Schimmelpilze, sogenannte Aflatoxine, deren krebserzeugende (Leber) Wirkung seit Jahren bekannt ist.
Der in der Öffentlichkeit vorherrschende Irrglaube, nach dem Nahrungsmittel keine Pflanzenschutzmittel-Rückstände enthalten dürften, ist nur eine der Gründe, warum nach einer Umfrage 78 Prozent der Deutschen Lebensmittel mit giftig in Verbindung bringen, die mit Pflanzenschutzmittel erzeugt worden sind. 85 Prozent der Befragten halten Lebensmittel für gesund, wenn diese ohne Pflanzenschutzmittel hergestellt sind. Laut BfR-Studie berichten die Medien überwiegend über die Risiken aber kaum über den Nutzen der Pflanzenschutzmittel, die zum Beispiel die gefährliche Schimmelpilz-Bildung verhindern können. Es ist nach den Worten Böls einfach ganz schwierig zu kommunizieren, das Pflanzenschutzmittel weltweit zu den weltweit bestuntersuchtesten Chemikalien zählen.
Nach der derzeitigen Wissensstand und mehr als tausend Untersuchungen zeigt Glyphosat nach Auskunft Böls keine erbgutverändernden Eigenschaften und im Tierexperiment keinerlei Hinweise auf krebserzeugende Wirkungen. Gedanken müsse man sich mehr über die Beistoffe, die sogenannte Netzmittel machen, die eventuell viel toxischer sind.
Deshalb habe das BfR gemeinsam mit dem Umweltbundesamt und allen europäischen Staaten der EU-Kommission empfohlen, den Grenzwert der „Akuten Referenzdosis“ von Glyphosat, also der Menge, die ohne erkennbares Gesundheitsrisiko täglich aufgenommen werden kann, von bisher 0,3 auf 0,5 mg/kg Körperfett zu lockern.
Autor: Gerhard Bernauer